Neue Studie von Branchenverband und Fraunhofer-Institut zeigt: Mit gezielten Förderungen könnte Europa bis 2030 PV-Module wettbewerbsfähig produzieren. Aktuell können Solarmodule made in Europe nämlich nicht mit den Preisen aus China konkurrieren.
Inhaltsverzeichnis öffnen
Marktanalyse von SolarPower Europe und Fraunhofer ISE
Eine neue Marktanalyse des europäischen PV-Branchenverbands SolarPower Europe und des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme will aufzeigen, dass die Wiederansiedlung der Photovoltaik-Modulfertigung in Europa mit den richtigen politischen Maßnahmen wirtschaftlich realisierbar wäre. Der Bericht „Reshoring Solar Module Manufacturing to Europe“ untersucht Kostenunterschiede zwischen EU- und chinesischen Modulen sowie die mögliche Wirkung verschiedener Förderinstrumente in der kurz- und mittelfristigen Zukunft.
Spannend ist zunächst die Analyse der Kosten: Derzeit ist die Herstellung eines Solarmoduls in Europa 10,3 Cent pro Watt Peak teurer als wenn das Modul in China produziert wird. Der Bericht schlüsselt das folgendermaßen auf: Die Ursachen dafür sind höhere Aufwendungen bei Maschinen (+40 Prozent), Gebäuden und Anlagen (+110 Prozent), Personal (+280 Prozent) und Material (+50 Prozent).
Die höheren Modulpreise wirken sich signifikant auf die sogenannten Stromgestehungskosten aus. Die beziffern, wie viel Cent die Kilowattstunde Strom, über die Lebensdauer einer Anlage gerechnet, durchschnittlich kostet. Bei großen Freiflächen-PV-Anlagen sind das 60,8 Cent pro Watt im Vergleich zu 50 Cent bei der Verwendung chinesischer Module; ein Kostenplus von 14,5 Prozent.
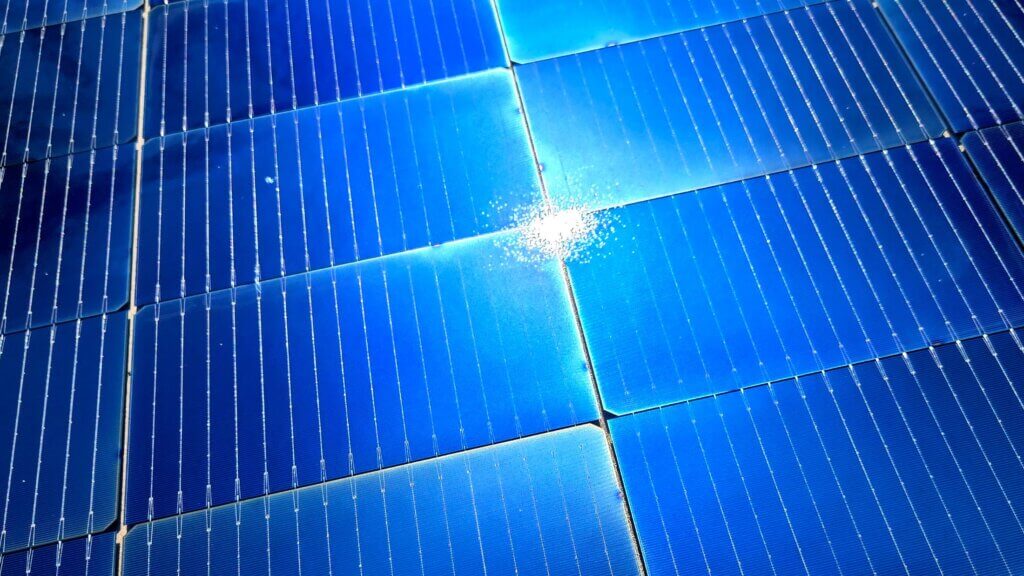
Preiskampf mit China: Kostenunterschiede durch Förderungen minimieren
Die Studie weist zudem auf eine Differenz von 2,2 bis 5,8 Cent pro Watt zwischen NZIA-konformen EU- und Nicht-EU-Modulen hin. NZIA (Net Zero Industry Act) steht für das Netto-Null-Industrie-Gesetz, das laut der EU-Kommision dafür sorgen soll, dass mehr saubere Technologien in der EU produziert werden. Konkret geht es dabei „um Technologien, die die Energiewende vorantreiben und nur geringe bis gar keine Treibhausgasemissionen verursachen.“
Mit gezielten Förderungen ließe sich laut dem Bericht die Kostendifferenz bei den Stromgestehungskosten auf unter zehn Prozent reduzieren. Empfohlen wird die Einrichtung eines leistungsbasierten Förderprogramms auf EU-Ebene für die Solarmodulproduktion; einschließlich einer Art Bonuspunkte-Initiative für „Made in EU“-Module bei Förderungen für Dachanlagen sowie bei öffentlichen Beschaffungsprogrammen.
30 Gigawatt ab dem Jahr 2030?
Um 30 Gigawatt europäische Produktionskapazität bis 2030 zu erreichen, wird laut der Studie ein jährlicher Förderbedarf von 1,4 bis 5,2 Milliarden Euro ermittelt. Knapp 40 Prozent dieser Kosten könnten durch makroökonomische Effekte kompensiert werden: Pro Gigawatt – so rechnen die Autoren der Analyse – könnten rund 2.700 Arbeitsplätze entstehen und etwa 66,4 Millionen Euro an Steuern und Sozialabgaben generiert werden.
Walburga Hemetsberger, CEO von SolarPower Europe, betont: „Europa kann mit den richtigen Maßnahmen bis 2030 wettbewerbsfähig 30 Gigawatt Solarenergie produzieren, Arbeitsplätze schaffen und eine widerstandsfähige Lieferkette aufbauen.“ Gleichzeitig mahnt Hemetsberger, dass diese Maßnahmen zeitnah kommen müssen – ohne EU-seitige Interventionen stünden die verbleibenden industriellen und technologischen PV-Produktionskapazitäten vor dem Aus.
Der Bericht prognostiziert: Bis 2030 würde der Aufbau einer europäischen PV-Produktionskapazität dieser 30 GW etwa 30 bis 50 Prozent des EU-Marktes versorgen. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, „müssten einzelne Fabriken eine Mindestgröße von 3 bis 5 Gigawatt Peak pro Jahr haben, sodass insgesamt sechs bis zehn solcher Anlagen in Europa errichtet werden müssten.“





